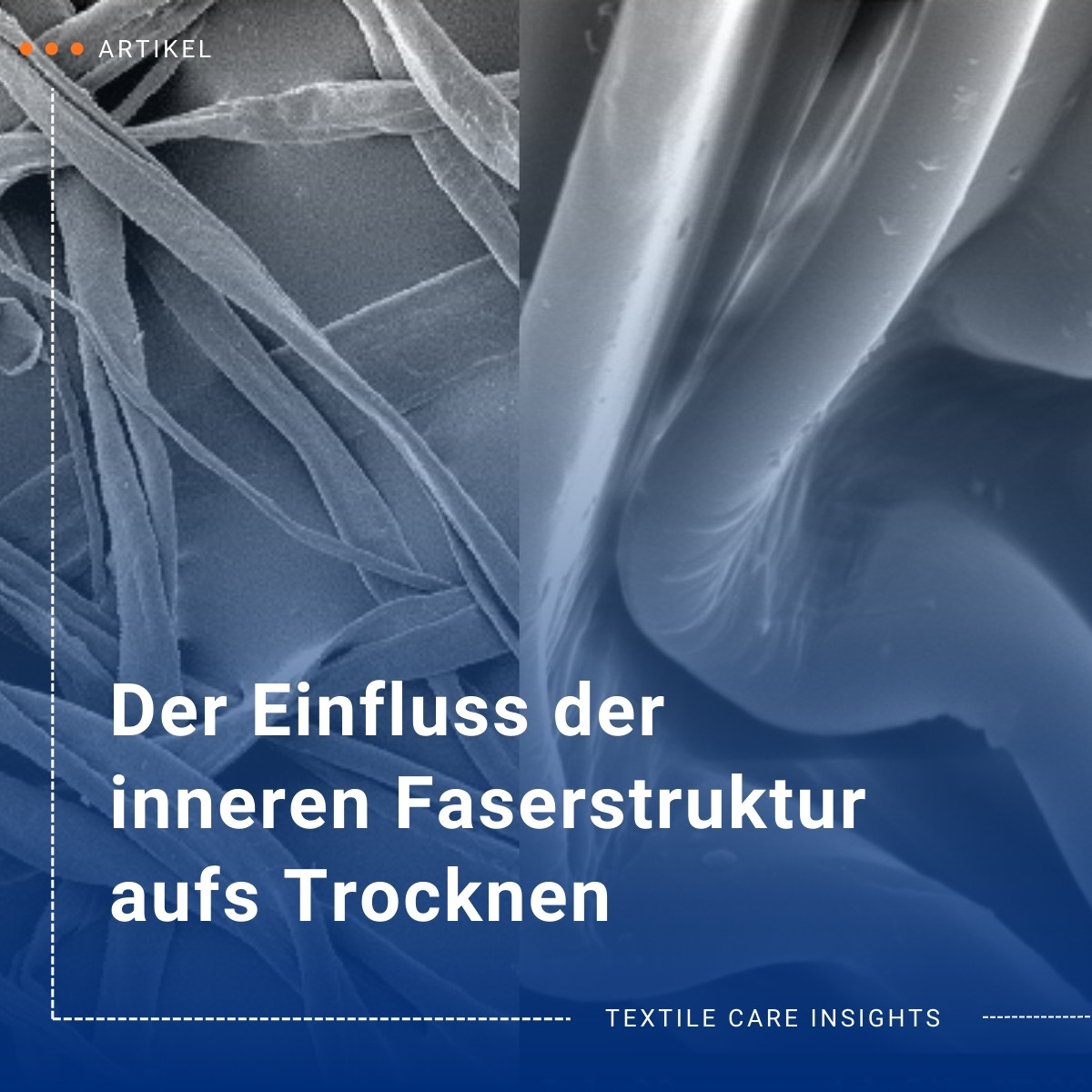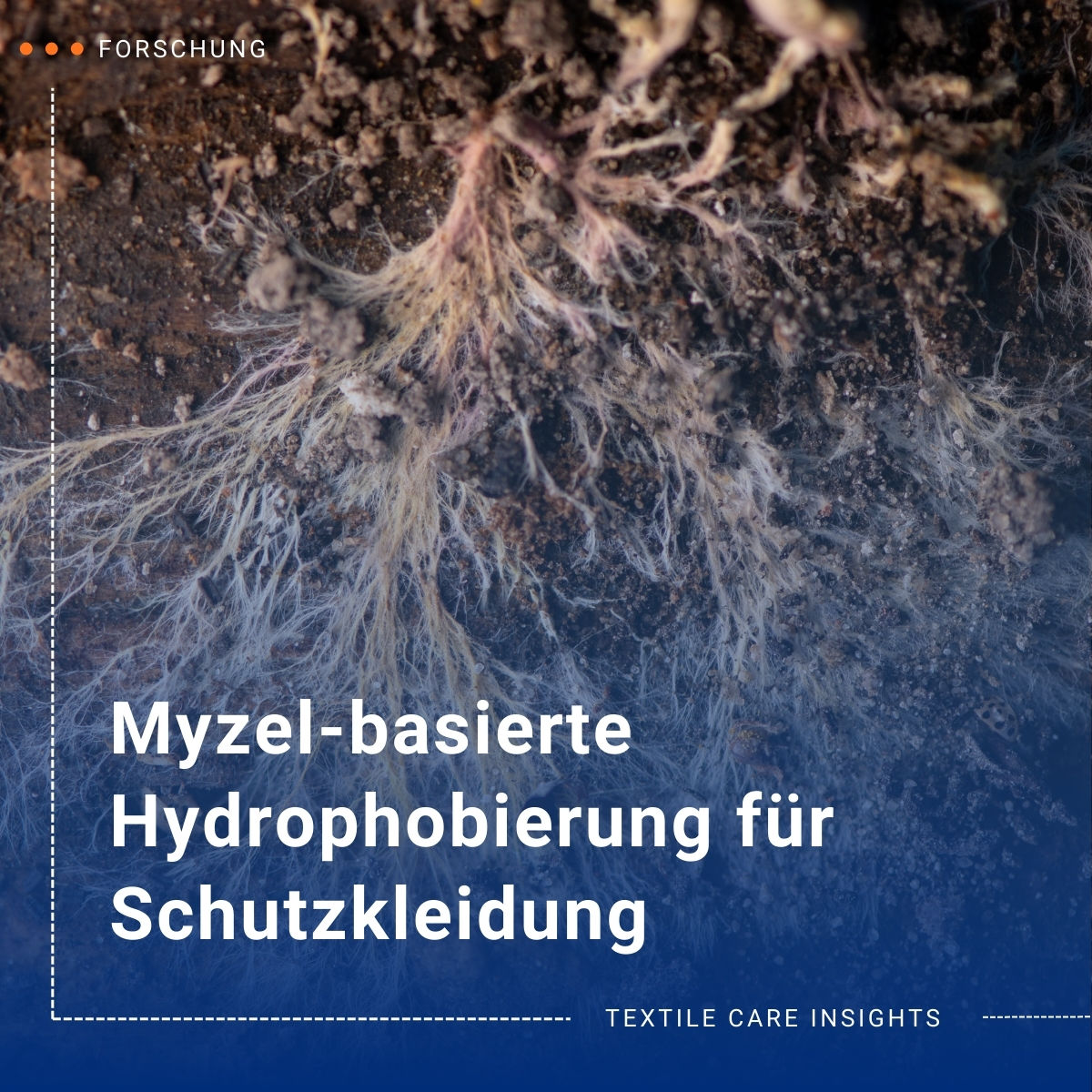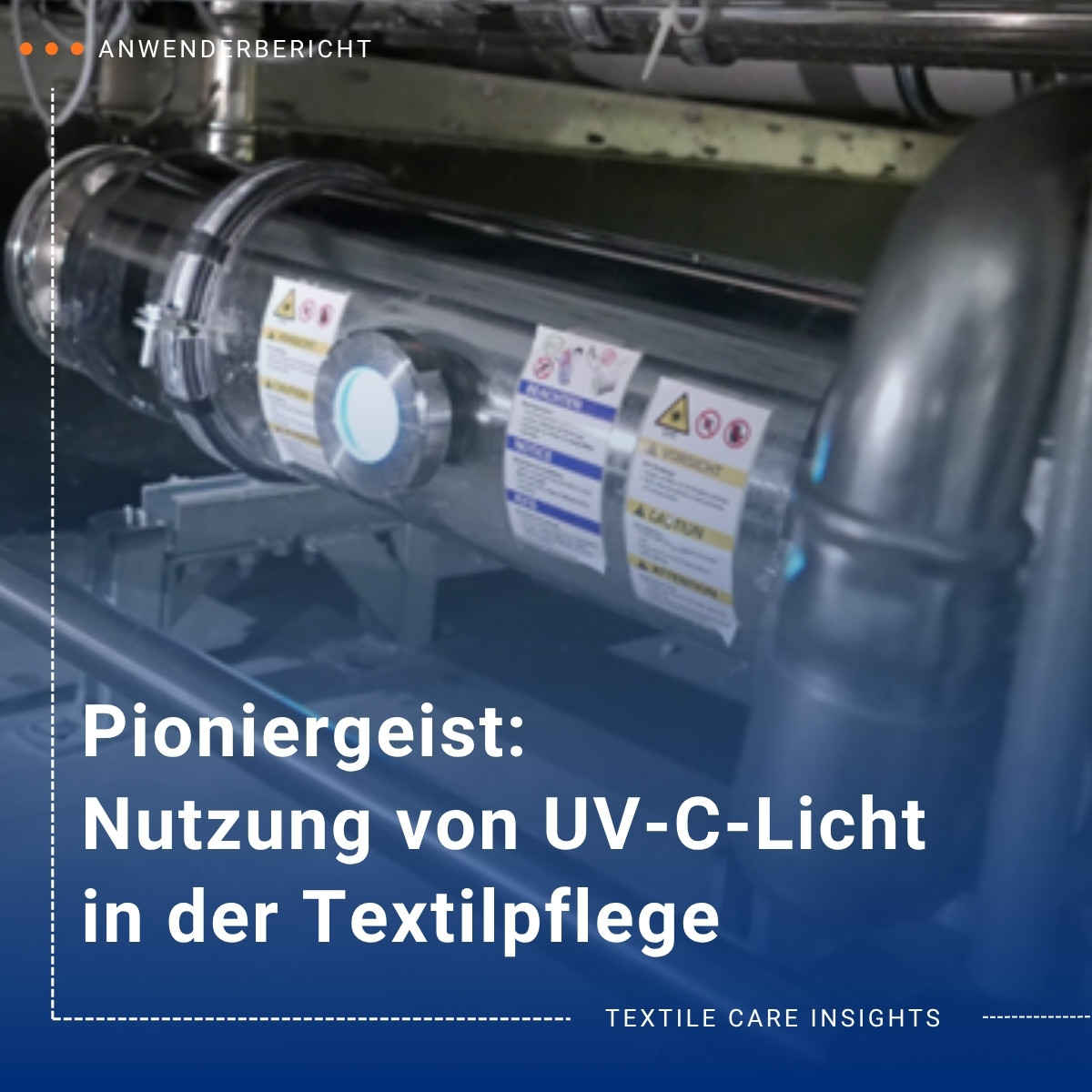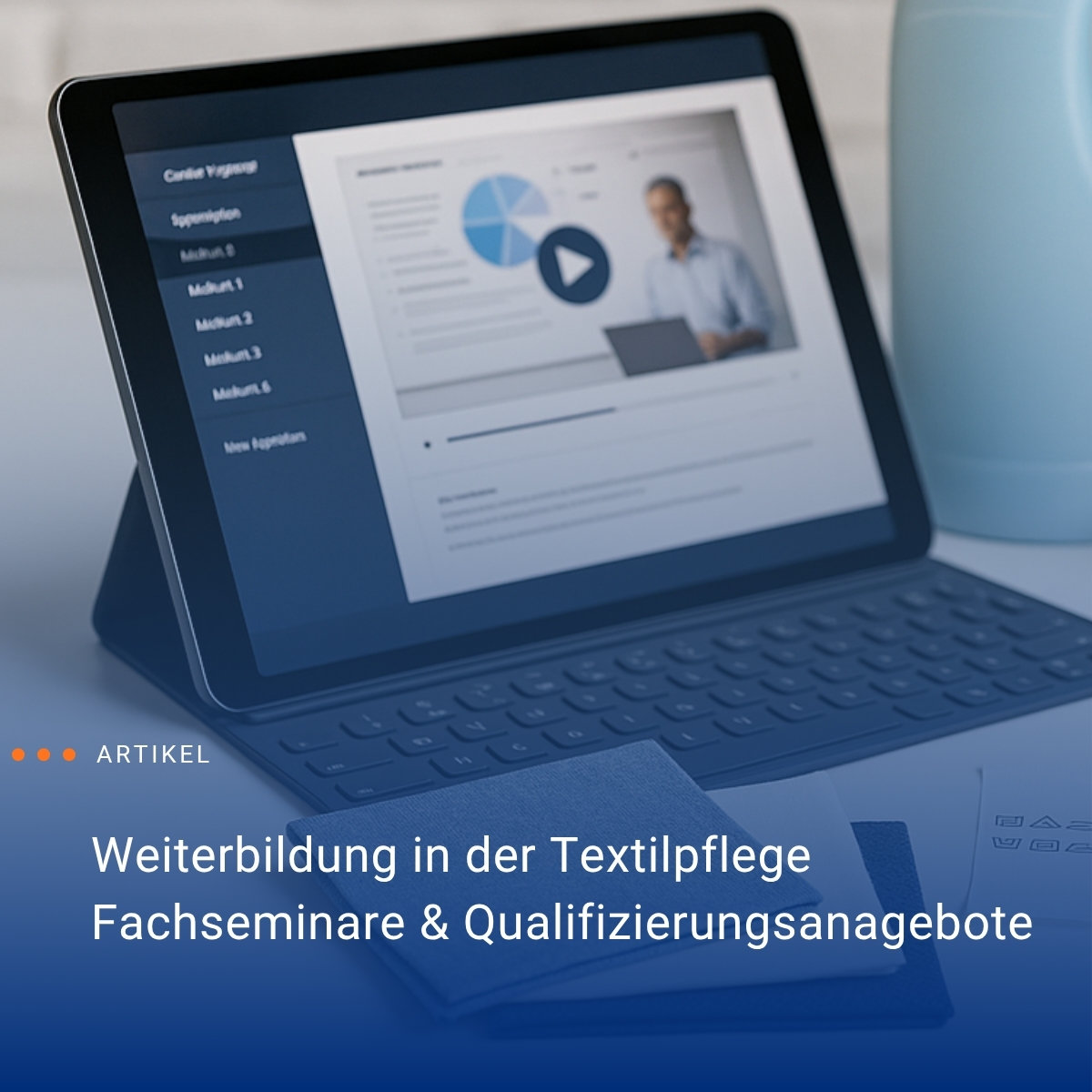Lesedauer: 3 Minuten
Noch bis kurz vor den 2000er-Jahre gestaltete sich der Zukauf neuer Berufskleidungskollektionen für Textilservice-Unternehmen als herausfordernd. Insbesondere, wenn ein neuer Lieferant auf die Bühne trat, musste eine umfangreiche Testmaschinerie in Gang gesetzt werden. Zwar hatten einzelne Unternehmen bereits eigene Prüflabore eingerichtet, in denen sie im Kleinmaßstab das großindustrielle Maschinenequipment nachstellten und die neuen Kollektionsteile intensiv testeten. Für die Mehrheit der Branche galt jedoch: Die Tauglichkeit musste unmittelbar in der Produktion nachgewiesen werden, wo sie nach zig Wäschen auf ihre Leasingeignung analysiert wurden. Dabei musste sie mit allen praktischen Unwägbarkeiten fertigwerden. Dazu zählte, dass die Teile nicht im Betrieb verlorengegingen oder unauffindbar waren. Dann waren die Vorarbeiten nicht nur aufwendig, sondern konnte sich viele Monate in die Länge ziehen, bis der Daumen nach oben oder unten wies.
Vom Empfehlungsstandard zur Industrienorm
Um deutlich schneller zu einem Ergebnis gelangen zu können, fehlte eine geeignete Prüfnorm. Diese erblickte auf Initiative von Wolfgang Quednau (BTTA, Mönchengladbach) und mehreren Branchenunternehmen im Jahr 2002 als ISO 15797 das Licht der Welt. „Vor Beginn der Normierungsarbeit gab es lediglich einen Standard als Pflegeempfehlung für Textilien mit nichtgewerblichen Wasch- und Trocknungsverfahren, die ISO 6330. Sie ist für die Nachbildung industrieller Pflegeprozesse aber vollkommen ungeeignet. Wir brauchten daher einen eigenen Standard. In diesem mussten die hohe Temperatur Waschmechanik und Alkalität der industriellen Wäsche wie auch die Bedingungen eines Tumbletrockners sowie eines Finishers allgemeingültig nachgebildet werden“, berichtet Wolfgang Quednau.
Industrielle Aufbereitung von Arbeitskleidung im Labormaßstab
Das Expertengremium aus Textilservice-Unternehmen, Maschinen- und Waschmittelherstellern definierte für die Norm die Prüfeinrichtungen, Referenzreagenzien und legte insgesamt acht Waschverfahren fest. Diese bilden die zu dieser Zeit typischen Aufbereitungsprozesse von Berufskleidung ab: Hygienewäsche mit Peressigsäure oder Wasserstoffperoxid für weiße Arbeitskleidung und/oder empfindliche farbige Besatzartikel, Chlorbleich-Verfahren für weiße Arbeitskleidung sowie ein Waschverfahren für farbige Arbeitskleidung.
Die Waschtemperaturen betragen – je nach eingesetztem Sauerstoffspender – 75°C bzw. 85°C bzw. wurden als Mindesthürde für das industrielle Waschen festgelegt. Um zudem der typischen Materialzusammensetzung von Berufskleidung gerecht zu werden, unterscheidet die DIN EN ISO 15797 zwischen einer vollen Beladung (z.B. für Baumwolle) und einer reduzierten Beladung. Diese ist zur Vermeidung einer Knitterbildung für Mischgewebe vorgesehen.
Um die Waschmechanik großindustrieller Maschinen im Labor nachbilden zu können, wurde auf sogenannte Semi-Scale-Waschmaschinen zurückgegriffen. Dabei war man sich bewusst, dass die gewählten Parameter – etwa Beladung, Flottenverhältnis oder die Ausführung der Trommelrippen – nicht der realen Praxis in einer industriellen Wäscherei entsprachen. Sie wurden aber so eingestellt, dass die mechanische Beanspruchung der Textilien derjenigen in großvolumigen Anlagen möglichst nahekam.
Nachdem ihrer Veröffentlichung im Jahr 2002 hat sich der Standard in der Textilpflege-Branche etabliert. Gewebe und Berufskleidungskollektionen werden, noch bevor sie auf den Markt kommen, in unternehmenseigenen oder akkreditierten Laboren nach der DIN EN ISO 15797 geprüft. Die Testläufe einer neuen Kollektion im Waschbetrieb lassen sich damit deutlich reduzieren. Außerdem vermeidet die Norm, dass ungeeignete Berufskleidung in einer Wäscherei zum Einsatz kommt.
Revision der ISO 15797 mit veränderten Grundlagen
Damit der Standard den aktuellen Entwicklungen in der Branche Rechnung trägt, wird er, wie jede Norm, in regelmäßigen Abständen überarbeitet, letztmals im Jahr 2018. Nun geht er erneut in die Revision. Seit Frühjahr 2025 erarbeitet eine Miniprojektgruppe, in der abermals Wolfgang Quednau tätig ist, neue Grundlagen für die Industriewaschnorm. „Die Waschverfahren haben sich stark verändert. Auch sind die im Standard festgelegten Trocknungsbedingungen und Messverfahren fachlich solide, lassen sich mit der vorhandenen Wäschereitechnik jedoch nur eingeschränkt umsetzen“, berichtet der Textil-Ingenieur. „Wir wollen die ISO 15797 auf der Basis des Sinnerschen Wirkungsmechanismus den tatsächlichen Gegebenheiten einer industriellen Wäscherei anpassen. Das ist insofern einfach, da die Waschparameter Zeit, Temperatur und Chemie definierbar und überprüfbar sind. Uns fehlt lediglich ein Mechanikmonitor, mit dem der Einfluss der Biege- und Reibmechanik in einer Industriewaschmaschine kontrolliert werden kann. Daran arbeiten wir – ebenso wie an einer praxistauglichen Methodik zur Bestimmung der Restfeuchte der Ware. Mit ersten Ergebnissen rechnen wir ab Mitte 2026; diese sollen anschließend in der zuständigen Normungsgruppe vorgestellt und diskutiert werden. Nach Abschluss der Revision soll sich die Prüfung von Arbeitskleidung unter industriellen Wasch- und Finishbedingungen deutlich stärker an der Praxis orientieren.“